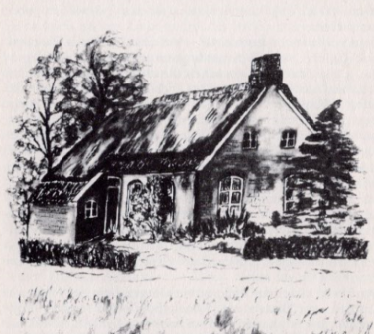
Wiesederfehn, heutiger Stadtteil von Wiesmoor, hatte seinen Ursprung 1796 mitten im Hochmoorgebiet und ist damit 100 Jahre älter als Wiesmoor. 1972 fusionierte Wiesederfehn mit Wiesmoor und hat seither eine rasante Entwicklung gezeigt.
Wiesederfehn auf der Campschen Karte von 1806.tfriesische Landschaft
Wiesederfehn – Erst im Jahr 1972 – im Zuge der Gemeindegebietsreform – wurde das bis dato selbstständige Wiesederfehn dem zentralen Ort Wiesmoor angeschlossen. Danach wuchsen beide Teile zusammen. Fast nur noch der schnurgerade verlaufende Grenzweg erinnert daran, dass es sich einst um zwei separate Kommunen mit sehr unterschiedlichem Alter handelte. Wiesederfehn wurde ab 1796 besiedelt, während 1906 als Entstehungsjahr Wiesmoors gilt.
Mitten im Hochmoor zu siedeln, irgendwo zwischen den Geestdörfern Wiesede im Osten und Strackholt im Westen, schien vor Jahrhunderten unmöglich. Durch das „Wieseder Moor“ zu gelangen, war mit Strapazen verbunden. Dann aber wollten sich drei Männer aus dem 30 Kilometer entfernten Stiekelkamperfehn eine neue Existenz aufbauen und erhielten vom Friedeburger Amtmann die Genehmigung zum Siedeln. Die rechtliche Grundlage lieferte das Urbarmachungsedikt, ein Erlass des preußischen Königs Friedrich II. vom 22. Juli 1765 für Ostfriesland.
Land für die ersten Siedler
Auf einem Landstück, wo die Torfmächtigkeit am geringsten war und schon im Mittelalter der Weg zum Hopelser Kloster abzweigte, hatte bereits zwischen 1790 und 1795 ein gewisser Eden eine Hütte errichtet – nach der das Aral am Hopelser Weg bis heute Hüttstück genannt wird. Während es hierfür keine offiziellen Belege gibt, stehen indes die Namen der nächsten Kolonisten fest: Wessel Gerdes Saatjer, Martin Janshen Simmering und Herbert Theen (oder Theyen) erhielten 1796 verbrieft die Erlaubnis, weshalb man sich bei der Gründung Wiesederfehns auf dieses Jahr beruft.
Sie bauten auf ihrem jeweils ein Hektar großen Landstück Holzfachwerk-Häuser mit Stroh und Lehm in der Nähe des um 1800 angelegten übersandeten Moorwegs von Wiesede nach Strackholt. Die Form des Sandrückens von Wiesede lässt sich noch heute am kurvenreichen Verlauf der Bundesstraße 436 erkennen, die bei Wiedederfehn in die gerade verlaufende Strecke durch Wiesmoor, das ehemalige Hochmoor, übergeht.
Der Auricher Feldmesser namens Von Northeim reiste am 27. Juni 1797 an, um am Ostrand vom „Wieseder Moor“ die Kolonatsgrundstücke zu vermessen. Bald war Wessel Ernst der vierte Siedler im Bunde. Nach der Jahrhundertwende wurden weitere Ländereien ausgewiesen, sodass man im Jahr 1820 24 landwirtschaftliche Häuser mit 111 Einwohnern zählte. Voraussetzung fürs Siedeln war, dass die Kolonisten den ihnen zugewiesenen Bereich kultivierten, was sich als beschwerlich herausstellte. Zur Fruchtbarmachung der Ländereien setzte man hier auf die Moorbrandkultur. Mittlerweile wurden in „Wieseder Veen“, so der behördliche Name seinerzeit, 100 Schafe gehalten. „Veen“ ist der niederländische Begriff für Moorweide.
Reine Landwirtschaft
Die Kolonistenfamilien bauten Buchweizen, Roggen und Schwarzhafer an, und sie hatten ein Einkommen durch den Verkauf von Brenntorf an Geest- und Marschbauern im Amt Wittmund und im Jeverland. Die 1883 gebaute Landstraße ermöglichte dann den besseren Transport von Dünger, Stroh und Spreu für Ackerbau und Zucht von Schweinen und Rindern – Wiesederfehn, dem Kreis Wittmund zugehörig, wuchs allmählich und gewann an Bedeutung.
Ab 1847 löste das Pferd allmählich das Rind als Zug- und Arbeitstier ab. Die Einwohnerzahl stieg und erhielt Mitte des 19. Jahrhunderts lediglich einen Einschnitt durch die Auswanderungswelle Richtung Amerika. 1890 zählte man 411 Personen.
Mussten die schulpflichtigen Kinder anfangs noch den Weg zum Schulunterricht in einer Kammer der Ziegelei Wiesede auf sich nehmen, so wurde 1819 die erste Schule am Ort eröffnet – die allerdings nur wintertags besucht wurde, weil der Nachwuchs im Sommer auf dem Feld oder beim Torfstechen benötigt wurde.
Etymologie des Begriffs „Fehn„
Einige Ortsnamen in Ostfriesland werden mit dem Gattungsbegriff Fehn (oder Veen, wie im Niederländischen) gebildet. Die Endung -fehn verweist darauf, dass es sich dabei um eine Moorsiedlung handelt. In niederdeutschen Urkunden aus dem 15. Jahrhundert bedeutet das Wort Fehn zunächst lediglich „Siedlung im Moor“, wie etwa im Beispiel Veenhusen. Erst nach der Anlegung von Großefehn (1633) bekam das Wort in Ostfriesland eine weitere, konkretere Bedeutung als terminus technicus für eine Moorsiedlung, die entlang eines eigens dazu gegrabenen Kanals, eines Fehnkanals, angelegt wurde. Gleichwohl entstanden in der Folgezeit auch Moorsiedlungen, die nicht entlang eines Fehnkanals angelegt wurden und trotzdem die Namensendung -fehn tragen. Im Allgemeinen wird unter einem Fehn (auch: Fehnsiedlung, Fehnkolonie) in der heutigen Wissenschaft dennoch eine Moorkolonie entlang eines Kanals verstanden. Zur genaueren Unterscheidung wird in der Literatur aber zuweilen auch zwischen „echten“ (mit Fehnkanal) und „unechten“ Fehnen (ohne Kanal) unterschieden.(2)
Verweise
(1) NWZ Online 23.03.2021
(2) Wikipedia
(F01) Das Lied der Moore, Richard Ahlrichs



